Leitung: Dr. Jens Clausen (Senior Researcher, Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit) und Dr. Maria Reinisch (Geschäftsführerin VDW e. V.)
VDW-Symposium „Von den Alpen bis zum Watt“ anlässlich des 85. Geburtstags von Hartmut Graßl | 25. September 2025
Einen Beitrag von Jahn Harrison zu diesem Thema finden Sie auch bei Klimareporter°.
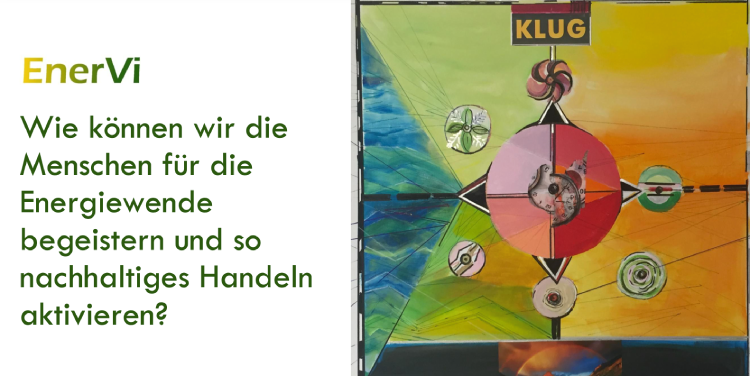
Wie erreichen wir mehr Menschen, damit die Energiewende gelingen kann? Welche Kommunikationsstrategien, Partizipationsformate und politischen Maßnahmen fördern nachhaltiges Verhalten wirklich?
Mit diesen Leitfragen befasste sich die interdisziplinäre Wissenschaftskonferenz „Energiewende mit Herz und Hirn – Wissen teilen, Menschen begeistern, Handeln ermöglichen“.
Fokus des Workshops waren die aktuellen Erkenntnisse aus dem Projekt „EnerVi – Individualisierte Visualisierung von Energiewendemaßnahmen“. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Ziel von EnerVi ist es, im Rahmen von partizipativ-gesellschaftlichen Prozessen systemübergreifend Innovationen zu entwickeln, um Verbraucher:innen die Folgen der Energiewende transparent zu machen und nachhaltiges Verhalten zu aktivieren. Hierzu hat das Projekt eine interaktive Website mit Energiewendemaßnahmen für Bürger:innen sowie eine KI-basierte Webapplikation entwickelt, die die Möglichkeiten der Energiewende und positive wie negative Klimawandelszenarien anhand von eigenem Bildmaterial der Nutzer:innen visualisiert.
Impulse aus Wissenschaft, Praxis und Politik
Unter der Leitung von Dr. Jens Clausen (Borderstep Institut) und Dr. Maria Reinisch (VDW e. V.) nahmen rund 25 Teilnehmende aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Bildung und Energiepraxis teil. Nach einer Begrüßung und Projektvorstellung folgten interdisziplinäre Beitrage zum Thema Kommunikation und Aktivierung im Kontext der Energiewende und -forschung.
Dr. Maria Reinisch – VDW e. V., Projekt EnerVi – AP4 Kommunikation & Transfer
Dr. Maria Reinisch präsentierte zunächst den gesellschaftlichen Wissenstransfer im Projekt EnerVi . Dieser stellt Emotion und Verständlichkeit in den Mittelpunkt. Ziel ist es, Akzeptanz und Verhaltensänderung durch positive, alltagsnahe Kommunikation zu fördern. Um dies zu veranschaulichen, wurden unter anderem Erkenntnisse aus den Modellregionen gezeigt. Eindeutig sichtbar war, dass es vielerorts ein hohes Maß an Engagement gibt, das jedoch vor finanziellen und planerischen Hürden steht.

Dr. Jens Clausen – Borderstep Institut, Projekt EnerVi – AP1 Szenarien künftiger Energieversorgung
Dr. Jens Clausen betonte, dass Kommunikation auf Normalität und konkrete Vorteile statt auf Innovation und Experimente setzen sollte. Menschen wollen keine „Versuchskaninchen“ sein – sichtbar gemachte Fortschritte schaffen Vertrauen. Finanzielle Anreize und konkrete Beispiele wie Kostenvorteile von E-Mobilität wirken stärker als abstrakte Klimaziele. Seine Kernbotschaft: Motivation entsteht durch erlebbaren, unmittelbaren Nutzen.
Dr. Friedrich Bohn – BAM Nachhaltigkeit Beratung Medien GmbH-VE
Dr. Friedrich Bohn zeigte, dass Katastrophenkommunikation („Doom Storytelling“) kaum Wirkung entfaltet und Menschen eher abschreckt, statt zum Handeln motiviert. Stattdessen sollten positive Narrative mit emotionaler Tiefe genutzt werden, die Sicherheit, Innovation und Lebensfreude verbinden. Er plädierte für eine neue Kommunikationskultur, die Wissenschaft nicht nur erklärt, sondern Menschen mitnimmt. Ziel ist dabei ein Nachhaltigkeitsnarrativ, das Hoffnung und Handlungsfähigkeit stärkt.

apl. Prof. Dr. Ulrike Jordan – Universität Kassel
apl. Prof. Dr. Ulrike Jordan präsentierte Erfahrungen aus Forschung, Lehre und kommunaler Praxis zur Wärmeplanung. Sie zeigte, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen übersetzt werden können: Von Wärmenetzen bis zu Solardörfern. Erfolgreiche Kommunikation verbindet Dringlichkeit mit lokalem Bezug und klarer Handlungsorientierung. Unterschiedliche Zielgruppen brauchen differenzierte Ansprache und sichtbare Erfolgserlebnisse.
Dr. Michael Buijzen – Gemeinde Schwalmtal
Dr. Michael Buijzen stellte Schwalmtal als Beispiel für kommunales Handeln in der Energiewende vor. Die Gemeinde setzt auf integrierte Strategien, Bürgerbeteiligung und kreative Formate wie den „Klimataler“ oder Nachhaltigkeits-Buchclubs. Kooperationen mit Projekten wie KOMM:WÄRME zeigen, wie Forschung und Praxis ineinandergreifen. So wird Partizipation zum zentralen Hebel für Akzeptanz und Umsetzung der Energiewende vor Ort.

Workshop: Potentiale und Herausforderungen
Im Anschluss an die Präsentationen wollten wir von den Teilnehmenden wissen und lernen: Welche Potentiale bringen sie mit, aber auch vor welchen Herausforderungen stehen sie in ihrem eigenen Kontext in Bezug Kommunikation und Aktivierung zur Energiewende?
Unter Anleitung von Jahn Harrison, VDW e. V. wurden im Workshopteil der Wissenschaftskonferenz die folgenden Potentiale und Herausforderungen der Teilnehmer:innen interaktiv geclustert:
Potentiale
Die Teilnehmenden identifizierten vielfältige Potenziale für das Gelingen der Energiewende. Im Bereich Energie und Bau standen Energieeinsparung, Klimaschutz und nachhaltige Baukonzepte im Vordergrund. Diese wurden durch positive Erfahrungen mit Sanierungen gestützt.
Politik, Verwaltung und Verbände wurden als zentrale Akteure gesehen, die durch rechtliche Expertise, Vernetzung und kommunale Wärmeplanung tragfähige Strukturen schaffen.
Die Wissenschaft hat das Potenzial durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und verständliche Wissensvermittlung Brücken zwischen Forschung und Praxis zu schlagen. Bildung und die Beteiligung junger Menschen wurden als Schlüssel zur langfristigen Veränderung betont, während bürgerschaftliches Engagement – etwa in Genossenschaften oder lokalen Initiativen – als Motor einer sozial verankerten Energiewende angesehen wurde.
In der Kommunikation soll der Fokus weg von Belehrung hin zu Erleben, Emotion und Storytelling führen. Schließlich gelten Innovation und die Unabhängigkeit von fossilen Energien als zentrale Treiber für Transformation und gesellschaftlichen Fortschritt.
Ergebnisse des gemeinsamen Austausches:
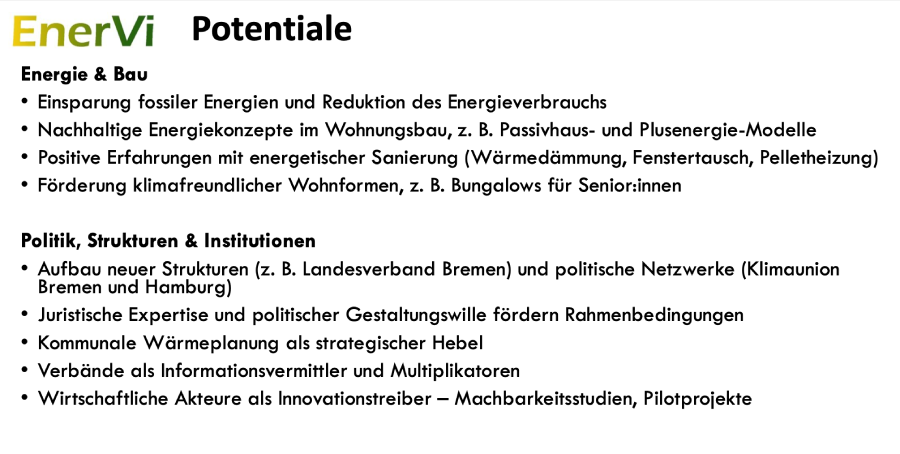
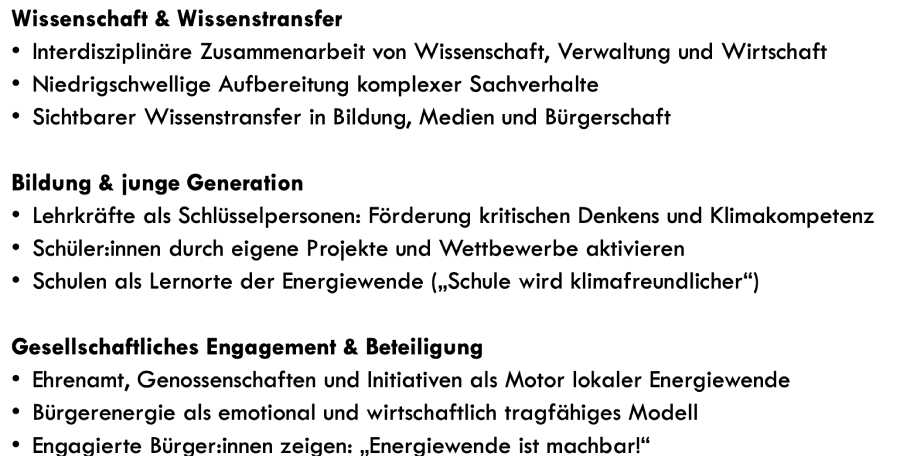
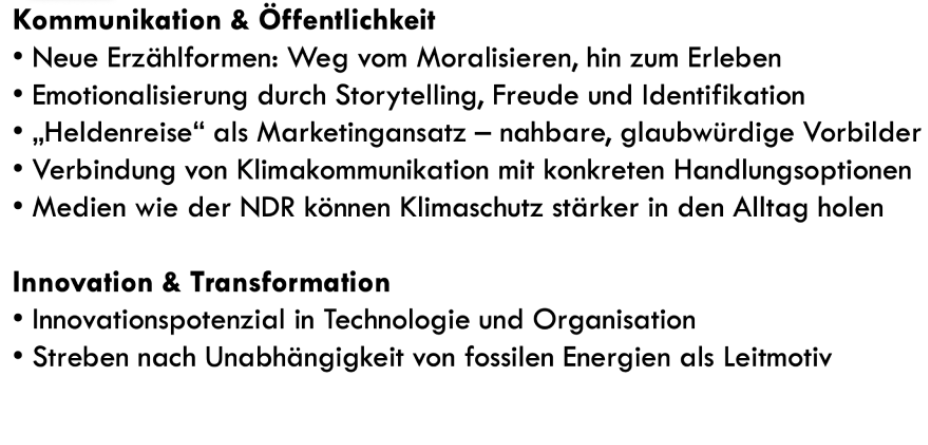
Herausforderungen
Die Teilnehmenden benannten zahlreiche Hindernisse, die sie in ihrem beruflichen oder ehrenamtlichen Engagement für die Energiewende erleben. Als zentrale Herausforderung gelten neben hohen Kosten, komplizierte Förderverfahren und fehlende Transparenz bei Zuständigkeiten, insbesondere für private Haushalte mit geringem Einkommen.
Der Mangel an Energieberater:innen und verständlichen Informationen erschwert zusätzlich die Umsetzung. Auch auf institutioneller Ebene sahen die Teilnehmenden Schwierigkeiten: Fachkräftemangel in Behörden, Zeitdruck, starre Lehrpläne und langfristige Bindungen bei Investitionsentscheidungen bremsen notwendige Prozesse.
Zugleich wird die Komplexität der Energiewende als überfordernd erlebt. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung dominieren laut den Teilnehmenden Angst vor Veränderung, Desinformation, fehlende Fehlerkultur und mangelnde Kommunikation über Erfolge. Viele Menschen fühlen sich erschöpft oder hoffnungslos. Im Bildungsbereich fehle es an Begeisterung und Freiraum für eigene Klimaprojekte. Darüber hinaus bemängelten die Teilnehmenden eine unzureichende lokale Beteiligung, Blockaden durch gezielte Gegenbewegungen („Climate Obstruction“) und individuelle Barrieren wie Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit oder das Fehlen inspirierender Vorbilder.
Ergebnisse des gemeinsamen Austausches:
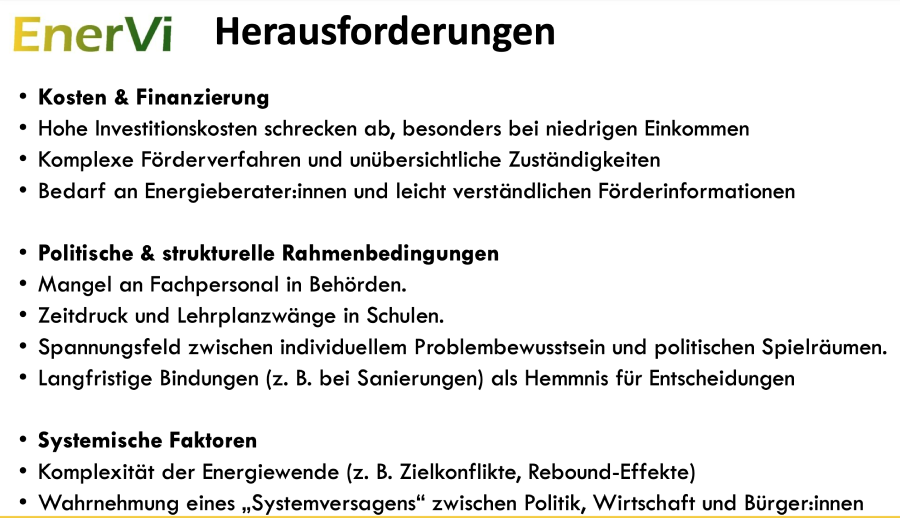
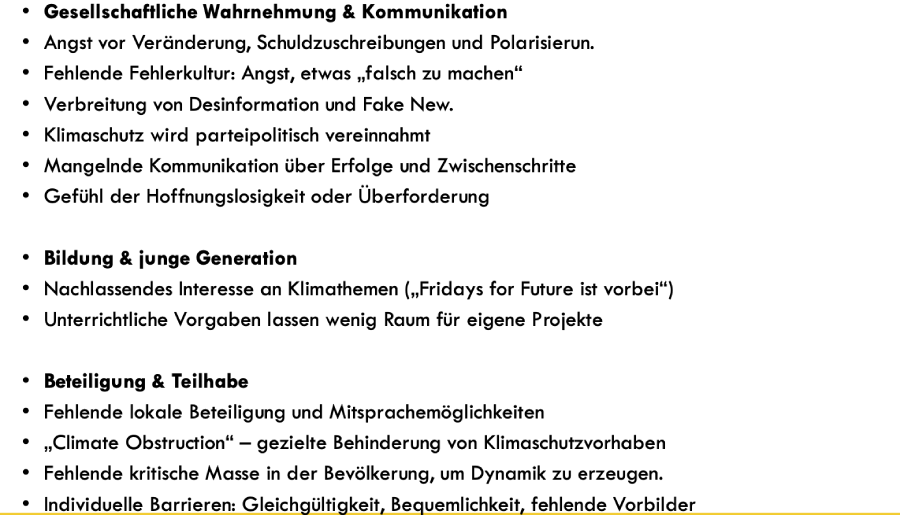
Diskussion und Fazit
Diese Landkarte der unterschiedlichen Herangehensweisen, Möglichkeiten und Herausforderungen bildete die Grundlage der Podiumsdiskussion. Diese zeigte deutlich: Wir stehen vor einer gewaltigen Herausforderung. Der Klimaschutz ist weitgehend aus der öffentlichen Debatte verschwunden, obwohl seine Bedeutung größer denn je ist. Viele der Teilnehmer:innen sehen ein Systemversagen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – zu viele Zahnräder greifen noch nicht ineinander. Umso wichtiger ist es, an vielen kleinen Stellschrauben zu drehen und insbesondere die Kommunikation neu zu denken.


Die Diskussion zeigte, dass die Energiewende nicht nur eine technische, sondern vor allem eine kommunikative und kulturelle – also eine soziotechnische – Aufgabe ist. Damit Akzeptanz und Beteiligung gelingen, müssen Information, Emotion und Mitwirkung zusammengedacht werden. Entscheidend ist eine zielgruppengerechte Ansprache, die Menschen sowohl rational überzeugt als auch emotional erreicht. Kurzum: Kommunikation mit Herz und Hirn.
Die Wissenschaftskonferenz des Projekts EnerVi und der Workshop boten hierfür wertvolle Impulse. Darauf aufbauend können Strategien aber auch neue Forschungsansätze für eine wirksame Energiewendekommunikation weiterentwickelt werden.
Autor: Jahn Harrison
