9. & 10. Oktober 2025 | „Lebenswelten. Ästhetik und Gesundheit“
Welchen Einfluss hat Ästhetik auf unsere Lebenswelten? Wie kann sie dazu beitragen, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen? Oder ist Ästhetik nur ein netter Luxus? Diese Fragen standen im Fokus des gemeinsamen Aktionstags an der Hochschule Coburg, organisiert vom Institut für Mensch und Ästhetik in Kooperation mit der Fakultät Bauen und Design sowie der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW).

Über zwei Tage hinweg boten zahlreiche hochkarätige Wissenschaftler aus verschiedensten Disziplinen spannende Vorträge und intensive Diskussionen. Die vielfachen Facetten der Ästhetik wurden beleuchtet – von neurowissenschaftlicher Wahrnehmung über philosophische und soziologische Perspektiven bis hin zu praktischer Architektur. Das durchweg positive Feedback der vielen Studierenden zeigte, wie bereichernd und inspirierend dieser interdisziplinäre Austausch war.
Vorträge, Impulse und Panels rund um die Ästhetik
Eröffnung
Prof. Dr. Stefan Gast, Präsident der Hochschule Coburg, hob die Bedeutung der Interdisziplinarität hervor und betonte die zentrale Rolle des Instituts für Mensch und Ästhetik. Das gemeinsame Institut der Hochschule Coburg und der Universität Bamberg ist in kurzer Zeit national wie international anerkannt worden. Es ist vernetzt mit renommierten Partnern wie der Georgetown University, der TU München und der Universität Cambridge sowie mit zahlreichen Fachgesellschaften und Instituten. Ästhetik als Querschnittsthema berührt all unsere Lebensbereiche – von Ingenieurwesen und Architektur bis zu Psychologie und Wirtschaft.
Dr. Maria Reinisch, Geschäftsführerin der VDW, formulierte Ästhetik als Schlüssel für Veränderung, der oft leise im Gehirn wirkt, dabei aber kraftvoll und wirksam ist. Der Aktionstag bot einen kreativen, interdisziplinären Raum, der Wissenschaft und Gesellschaft verbindet und damit transdisziplinäre Zukunftsgestaltung vorantreibt.

© institutaesthetik.de

© institutaesthetik.de
Vorträge
Prof. Dr. Michael Heinrich – Die Wirkkraft der Ästhetik im Alltag
Prof. Heinrich, Leiter des Instituts Mensch und Ästhetik sowie Studiendekan an der Hochschule Coburg, stellte vor, wie Räume entstehen können, die mehr sind als funktionale Umgebungen: Sie berühren uns, geben Orientierung und fordern uns heraus. Seine Arbeit verbindet Ästhetik mit Architektur und Psychologie, erforscht die Wirkung von Formen, Farben und Materialien auf unser Empfinden und entwickelt daraus Leitlinien für menschlichere Lebenswelten. Dabei ist der interdisziplinäre Schulterschluss für nachhaltige Lösungen unabdingbar.
Prof. Dr. Christian Illies – Philosophie als Fundament der Ästhetik
Prof. Illies verknüpfte wissenschaftlich-philosophische Forschung mit gesellschaftlicher Verantwortung. Er erläuterte, wie Ästhetik unser Bewusstsein, unsere Seele und unser Menschenbild prägt. Philosophen wie Kant und Sokrates näherten sich ästhetischen Fragen mit unterschiedlichen Methoden, die verdeutlichen, dass Ästhetik nicht nur subjektives Schönheitsurteil, sondern auch Orientierungshilfe und Ausdruck einer kulturellen Reflexion ist. Die vielfältigen philosophischen Bilder zeigen, wie tief Ästhetik in der menschlichen Kultur verwurzelt und für das Zusammenleben bedeutsam ist.
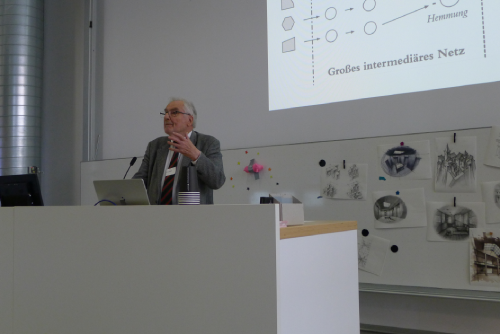
© institutaesthetik.de
Prof. Dr. Ernst Pöppel – Neurowissenschaftliche Perspektiven auf Ästhetik
Der Hirnforscher Prof. Pöppel, zugleich Vorstand der VDW, präsentierte die neuronalen Grundlagen unserer ästhetischen Wahrnehmung. Mit Bezug auf Kant („Schön ist, was ohne Begriff allgemein gefällt“) illustrierte er, wie unsere Sinnesorgane begrenzte Ausschnitte der Welt erfassen und wie das Gehirn komplexe Netzwerke aktiviert, um Wahrnehmung, Gedächtnis, Emotionen und Absichten zu verknüpfen. Dabei werden zeitliche Organisationsmechanismen sichtbar, die innerhalb von Millisekunden Informationen bündeln und über wenige Sekunden hinweg Sinnzusammenhänge herstellen – etwa beim Sprechen oder Umarmen.
Panels
Panel 1: Psychologie und Neuroästhetik
Prof. Niko Kohls leitete das Panel zu „Wie Ästhetik unsere Empfindungen beeinflusst“. Prof. Claus-Christian Carbon zeigte, wie neuronal unterschiedliche Wahrnehmung zu variierender Erfahrung von Schönheit führt. Er erläuterte die Abgrenzung von ästhetisch, schön und hübsch und wies auf die Fähigkeit der Wahrnehmung hin, mehr zu erfassen als bloße Einzelteile – somit entstehen auch „nicht vorhandene“ Eindrücke. Der Halo-Effekt und der menschliche Wunsch nach Attraktivitätssteigerung treiben eine globale Schönheitsindustrie an. Ziel von Carbons Arbeit ist die systematische Erfassung und ethische Bewertung dieser Prozesse. Fachpodiumsteilnehmer diskutierten, wie Ästhetik individuell Motivation und Begeisterung fördert und wie ein philosophisch fundierter Rahmen Wahrnehmung prägt.
Panel 2: Philosophie, Soziologie, Ökonomie, Technologie
Prof. Christian Illies moderierte das Panel Philosophie, Soziologie, Ökonomie, Technologie. Dieses begann mit einem Impulsvortrag von Prof. Michael von Brück, emeritierter Religionswissenschaftler und Zenmeister. Er erläuterte den Begriff der Ästhetik in China und Indien, wo die Architektur gesellschaftliche Ordnungen und Harmonieprinzipien wie Yin und Yang repräsentiert. Räume sind Schutz, Plattformen für Begegnung und Ausdruck kultureller Werte. Die Spannung zwischen Neugier (Unheimlichem) und Sicherheit (Vertrautem) prägt die Gestaltung ebenso wie das Ineinandergreifen von Vertrautheit, Schönheit und Überraschung. Vergleiche der kulturellen Architektur zeigen Unterschiede, etwa langlebige Steinbauten in Indien und China versus ritualisierte Holzbauweise in Japan. Die anschließende Diskussion ging auf Einflüsse von Rhythmus, Ironie und KI in der Ästhetik ein.
Panel 3: Gesundheit und Prävention
Unter Leitung von Prof. Kohls behandelte das Panel die Wirkung von Umfeld-Ästhetik auf Wohlbefinden und Resilienz. Prof. Thomas Bohrer, Thoraxarzt und Gründer des Philosophikum, zeigte, dass Medizin mehr als Biologie ist: Sie ist beziehungsorientiert und eingebettet in ästhetische Erfahrungen, die Räume für Sinn, Selbst und Heilung schaffen.

© institutaesthetik.de

© institutaesthetik.de
Besonders in der Palliativmedizin helfen ästhetisch gestaltete Umgebungen und Pflanzen, Ängste zu mindern und Vertrautheit zu schaffen. Meditation und sinnvolle Raumgestaltung fördern Resilienz und Gesundheit. Prof. Sandbothe beschrieb meditative Praktiken im Unterricht, Prof. Pöppel veranschaulichte die elementare Verbundenheit aller Dinge am Beispiel des Atems. Abschließend betonte das Panel die Notwendigkeit, eigene geistige Beschränkungen („Dummheit“) bewusst herauszufordern, um gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern.
Panel 4: Architektur und Design
Moderiert von Prof. Mark Phillips, Experte für nachhaltiges Bauen an der Hochschule Coburg, diskutierten Andrea Wirth, Prof. Michael Heinrich, Prof. Illies und Prof. Kohls die humanorientierte Konzeption von Lebenswelten. Im Spannungsfeld zwischen Auftraggebern, Nutzern und globalen Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit sind nachhaltige, sinnvolle Lösungen gefragt. Essenziell ist die Berücksichtigung sich wandelnder Bedürfnisse über verschiedene Zeiträume und deren sensorische Umsetzbarkeit.
Ästhetik wurde als normativer Rahmen verstanden, der ein Umdenken mit reduzierter Ressourcennutzung ermöglicht, wobei „Weniger“ oft mehr Lebensfreude bedeutet. Komplementäre Bedürfnisse – Individualität und Gemeinschaft, Offenheit und Geborgenheit, Naturverbundenheit und urbaner Nutzen – können auf Gemeinschaftsebene harmonisch verbunden werden. Eine ästhetisch gestaltete Umwelt fördert Wohlbefinden und nachhaltige Lebensweisen. Öffentliche Innenhöfe als ästhetische Begegnungsorte können auch Demokratiebildung stärken und gesellschaftliche Herausforderungen adressieren.
Keynote
Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, legte dar, wie durch ressourcenschonendes Bauen Qualität gesteigert und Klimabelastungen reduziert werden können. In Deutschland liegen pro Kopf 361 Tonnen Baumaterial in Gebäuden und Infrastruktur – vergleichbar mit einem vollbesetzten sechsteiligen ICE. Der Energieverbrauch für Bauen ist enorm. Neubauten verbrauchen dabei besonders intensiv. Über 80 % der Bevölkerung befürworten daher Wohnraumerweiterung durch Umbau und Aufstockung bestehender Gebäude.
Nagel warnte vor Flächenüberlastung und forderte einen Aufbruch zu neuen Wohnformen. Nachhaltigkeit erfordert soziale Teilhabe und Engagement, etwa durch bewussten Einkauf vor Ort statt Onlinehandel. Kleine Maßnahmen wie Tempolimits, breitere Fußwege und bereichsübergreifende Koordination verbessern Lebensqualität und Effizienz.
Er wies auf die Chancen des demographischen Wandels hin: 1,5 Millionen Wohnungen in Deutschland werden von über 85-Jährigen bewohnt, von denen viele bald frei werden. Studien zeigen, dass Menschen längere Wege zu Fuß in Kauf nehmen, wenn die Wege attraktiv gestaltet sind.
Nagel plädierte für zirkuläres Bauen mit natürlichen Materialien wie Holz, Naturstein und Begrünung, statt Beton und Stahl. Durchlässigkeit, Offenheit und Geborgenheit sind wichtige Gestaltungsprinzipien. Die Idee einer „Behörde für Schönheit“ soll Ästhetik und Bedürfnisse stärker in kommunale Planungen integrieren.
Der Erhalt und Umbau vorhandener Bausubstanz – von „grauer“ zu „goldener“ Energie – bewahrt materielle und immaterielle Werte und schafft lokale Wertschöpfung. Nur mit aktiver Einbindung der Menschen vor Ort gelingt ein ökologisch, ökonomisch und sozial sinnvoller Umbau.

© institutaesthetik.de
Abschluss und Ausblick
Prof. Michael Heinrich und Dr. Maria Reinisch fassten das Symposium eindrücklich zusammen: Ästhetik ist ein zentraler Hebel der Transformation, der seine volle Kraft nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit entfaltet – von den neuronalen Grundlagen bis hin zur gebauten Umwelt.
Die großen Herausforderungen unserer Zeit – Klimawandel, soziale Spaltung, Ressourcenknappheit – lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Die Offenheit für unterschiedliche Fachkompetenzen, der Respekt vor Expertenwissen sowie die entschlossene Haltung, Veränderung anzustreben, setzen enorme positive Kräfte frei. So entstehen innovative Lösungen, die das Miteinander stärken und nachhaltige Veränderungen ermöglichen.
Das Institut Mensch & Ästhetik (IMAE) in Coburg bildet dabei einen lebendigen Hub, der interdisziplinäre Forschung, Lehre und Praxis verknüpft, Innovation fördert und Wirkung sichtbar macht. Die VDW vernetzt bundesweit interdisziplinäre Hochschulen, Kommunen und Institutionen im Sinne verantwortlicher Wissenschaft.
Wenn Sie Anknüpfungspunkte für Ihr Projekt oder Ihre Einrichtung sehen, laden wir Sie herzlich ein, Kontakt aufzunehmen. Gemeinsam können wir Kräfte bündeln, innovative Lösungen gestalten und eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft schaffen. Ästhetik ist dabei der Motor und Rahmen für gesellschaftlichen Wandel und gelingendes Zusammenleben.

© institutaesthetik.de

